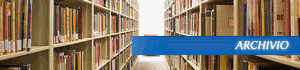Da haben sich Dilettanten blind in etwas hineingestürzt
 “Da haben sich Dilettanten blind in etwas hineingestürzt”
“Da haben sich Dilettanten blind in etwas hineingestürzt”
Interview von Clemens Wergin mit Romano Prodi auf der Welt vom 30. April 2019
Der frühere EU-Kommissionspräsident Romano Prodi fordert, Europa müsse gegenüber den großen Staaten der Welt zusammenzustehen. Sonst werde der Kontinent zum Spielball der anderen – so wie sein Heimatland Italien.
Der ehemalige EU-Kommissionspräsident Romano Prodi ist ins Verlagshaus von Axel Springer in Berlin gekommen, um den scheidenden Aufsichtsratsvorsitzenden Giuseppe Vita zu verabschieden. Prodi, der die Kommission von 1999 bis 2003 leitete, ist älter geworden und nuschelt noch immer wie ehedem. Aber wenn es um Europa geht, ist der Wirtschaftsprofessor noch stets zu leidenschaftlichen Ausbrüchen fähig. Nach dem Gespräch lässt er sich anrufen, um den Klingelton seines Handys zu demonstrieren. Es erklingt Beethovens Ode an die Freude. Die
schönste Hymne der Welt, wie Prodi findet. Die Hymne seines geliebten Europas.
Seit Sie Präsident der EU-Kommission waren, hat sich viel verändert in Europa. Wenn Sie Ihre damalige Zeit mit der heutigen vergleichen, was fällt Ihnen da am stärksten auf?
Es hat sich alles verändert. Als ich die Kommission verließ, befanden wir uns an einer Wasserscheide. Europa war im Aufstieg begriffen – der Euro, die Erweiterung, mit allen Problemen, die das mit sich brachte. Europa machte also immer Schritte nach vorne. Und dann kam 2005 das französische Referendum, und Europa veränderte sich.
Es kam zum Stillstand.
Die supranationalen Strukturen kamen zum Stillstand, die Kommission verlor an Macht. Die wanderte zum Europäischen Rat. Der Rat verkörpert jedoch nicht die supranationale Struktur, sondern die einzelnen Nationalstaaten, und das hat Europa verändert. Dann begannen die Allianzen, die Spannungen. Danach kam es zur Spaltung, die Spannung zwischen Nord und Süd, Ost und West, das Problem Deutschlands, die Spannungen mit Griechenland. Europa kam aus dem Gleichgewicht, und auch die deutschfranzösische Achse, die essenziell ist für den Kurs Europas, war von Problemen und Krisen geprägt.
In der Vergangenheit haben Sie die Dominanz Berlins in Europa kritisiert. Wie kam es zu dieser führenden Position Deutschlands?
Das ist das Resultat seiner Stärke. Deutschland ist wegen seiner Tugenden, nicht seiner Sünden in diese Position gekommen und auch durch die Schwäche anderer. Aber Führung bedingt auch Verantwortung. Der Fall Griechenlands ist für mich schmerzhaft, auch wenn ich zu den Ersten gehörte, die anerkannt haben, dass Athen betrogen hatte. Aber es gab einen Moment, an dem das Problem noch klein war, man hätte das damals lösen können mit nur 20 oder 30 Milliarden Euro. Stattdessen hat die deutsche Öffentlichkeit das als Zeichen verstanden, um notwendige Härte zu zeigen.
Deutschland hat recht, dass die Regeln befolgt werden müssen, und als ich Ministerpräsident Italiens war, habe ich das Defizit drastisch reduziert. Ich war aber auch immer der Meinung, dass Deutschland damals aus Eigeninteresse und im Interesse Europas eine expansivere Geldpolitik hätte betreiben sollen. Denn damit hätten die Deutschen die Krise abfedern können, so, wie es die Amerikaner gemacht haben. Stattdessen wurde die Politik national, und es war schwierig, einen Vermittler zu finden, der das kollektive Interesse verfolgte.
Anfang des Jahres haben Sie eine Kampagne für das Zeigen der europäischen Flagge in Italien gestartet. Was war die Idee dahinter?
Wir brauchen nicht nur politische Operationen, sondern auch Symbole. Wir brauchen eine europäische Flagge, die von den Bürgern auch benutzt und hergezeigt wird. Weil eine Flagge immer ein Symbol des Schutzes und der Einheit ist. Wir haben in Europa die schönste Hymne der Welt, aber die Flagge ist kaum bekannt und wird kaum benutzt, obwohl jede Identität eine Fahne benötigt. Die Kampagne läuft in Italien sehr gut, etwa bei Demos. Wenn die Jungen sich auf Plätzen zusammentun oder feiern, dann tun sie das nun mit der europäischen Flagge. Das ist sehr wichtig für die Zukunft.
Italiens Entscheidung, sich an der neuen Seidenstraße zu beteiligen, ist in Europa mit Kritik aufgenommen worden. Viele sehen das als Versuch der Chinesen, Europa zu spalten.
Prodi: Prodi: Es ist nicht im Interesse Chinas, Europa auseinanderzudividieren. Tatsächlich ist das Abkommen mit Italien absolut zu vernachlässigen. Es war nur ein großer Fehler der italienischen Regierung, diesen Schritt im Verborgenen zu tun.
Dann hat Rom das Abkommen wegen der Kritik noch einmal verändert.
Da haben sich Dilettanten blind in etwas hineingestürzt. Das ist, was in Wahrheit passiert ist. Weil die echten Geschäfte mit China dann Macron und Merkel gemacht haben.
Europa durchlebt gerade einen populistischen Moment. In vielen Ländern gibt es einen Aufstand gegen nationale und europäische Eliten. Was antworten Sie diesen europäischen Bürgern?
Ich antworte, dass diese Menschen noch nicht verstanden haben, dass auf jeden Italiener 23 Chinesen kommen und auf jeden Deutschen 16 Chinesen. Wenn wir gegenüber den großen Staaten in der Welt nicht zusammenstehen, dann sehen wir uns der Macht anderer ausgesetzt. Wenn ich mit Studenten rede, dann nehme ich die italienische Geschichte als Beispiel. In der Renaissance waren die italienischen Staaten auf allen Gebieten führend, bei der Kunst, den Finanzen. Dann kam es zur ersten Globalisierung, als Amerika entdeckt wurde. Wir Italiener haben uns nicht vereint, und als Folge waren wir nicht in der Lage, die neuen Karavellen zu bauen, die notwendig waren. Nur die Reiche Englands, Frankreichs und Spaniens waren dazu fähig. Italien ist daraufhin für vier Jahrhunderte von der Landkarte verschwunden.
Was sind heute die neuen Karavellen? Google, Apple, Alibaba, Ebay, Amazon. Keines davon ist europäisch, sie sind alle amerikanisch oder chinesisch. Wollen wir also auch von der Landkarte verschwinden? Das ist mein Europäertum. Es schaut nur in die Zukunft. Wenn ich stattdessen von Europa rede, das Frieden gebracht hat, schauen mich die Jungen an wie einen Dinosaurier. Die halten das für selbstverständlich.
Was ist Ihrer Meinung nach der Grund für den Populismus?
Er nährt sich in erster Linie aus dem großen Wohlstandsgefälle, das auch Folge der technischen Veränderungen ist. Es geht auch um Arbeitsplätze, die abwandern. Es gibt dieses sehr ernst zu nehmende Gefühl, immer mehr Personen glauben, dass sie nicht mehr geschützt werden. Und sie meinen, dass die Elite, die Meritokratie, sich stetig von den normalen Menschen entfernt hat und sie nicht mehr schützt. Sie sagen, das ist nicht nur ein Problem der Reichtumsverteilung, sondern wenn es zu einer Krise kommt, dann schickt ihr eure Kinder ins Ausland, um zu studieren. Ihr habt immer einen Rettungsfallschirm, den wir nicht haben. Wenn unsere Firma in die Krise gerät, sitzen wir ohne Arbeit zu Hause. Und das ist das Problem, das den Populismus hat groß werden lassen.
Es geht also darum, eine Politik zu verfolgen, die deutlich macht, dass Europa uns einerseits an die Vorfront von Innovation und Forschung bringt, uns jedoch gleichzeitig auch schützt. Beispiel Silicon Valley. Der einzige Versuch, diese Macht einzuhegen, kam vom EU-Parlament. Die einzige Gegenmacht in der Welt. Kein einzelnes Land wäre in der Lage gewesen, das zu tun.
Viele, die sich als Proeuropäer verstehen, wollen immer mehr Integration in der EU. Doch diese Vision schafft immer mehr Gegenkräfte in EU-Ländern. Wäre es nicht besser, eine Pause zu machen und das zu retten, was wir schon erreicht haben?
Wie sollen wir bewahren, was wir erreicht haben, wenn wir es nicht vollenden? Als der Euro geboren wurde, sagte ich zum damaligen deutschen Kanzler Helmut Kohl: „Helmut, wir müssen auch Fortschritte machen bei Steuerregeln, für Unternehmen, die in Konkurrenz zueinander stehen. Wenn wir Steuerparadiese weiter zulassen, dann wird das nicht gut gehen, der Euro wird nicht halten.“ Seine Antwort war: „Du bist Italiener, du weißt, dass Rom nicht in einem Tag erbaut wurde. Das machen wir später, wenn wir weiter vorangehen.“ Das Problem ist, dass sich die Umstände inzwischen geändert haben. Wie können wir nur weiter Steuerparadiese innerhalb Europas dulden? Wenn der irische Staat sich weigert, 13 Milliarden Steuern von Apple zu verlangen, weil er ein Interesse daran hat, Steuerparadies zu bleiben, dann läuft etwas falsch.
Sie sind also der Meinung, dass Europa immer weiter integriert werden muss?
Wir müssen in diese Richtung weitergehen, auch wenn das offensichtlich ein Europa unterschiedlicher Geschwindigkeiten bedeutet. Und es könnte sein, dass Italien da nicht bei der höchsten Geschwindigkeit dabei ist. Das würde mich traurig machen, aber ich würde auch das akzeptieren, nur damit es vorangeht. Wenn Europa stehen bleibt, ist es am Ende. Dann werden wir immer mehr Populismus bekommen. Dieser Populismus wurde in dem Moment geboren, als Europa anfing, Entscheidungen auszuweichen. Man kann kein Europa der Hygieneregeln, der Hühnerstallregularien und der Gemüsetransportregeln lieben. Das sind alles nützliche Dinge, aber man verliebt sich nicht in Hühnerställe. Wer also die Agenda nicht auf die Reihe bringt, hat verloren. Und dann enden wir alle wie die venezianische Republik oder die genuesische. Wir brauchen also unterschiedliche Geschwindigkeiten und müssen anfangen, Einstimmigkeitsregeln aufzugeben und Mehrheitsentscheidungen zuzulassen.
Italiens Regierungschef Giuseppe Conte hat in WELT ein europäisches Demos gefordert, also ein europäisches Volk. Wie soll das gehen, wenn wir nicht mal eine gemeinsame Sprache haben?
Hat Indien eine gemeinsame Sprache?
Ja, das Englische.
Wir haben auch Englisch, wenn jetzt Großbritannien ausscheidet, dann kann es ohne Probleme die gemeinsame Sprache werden. Sprache ist sicher ein sehr wichtiges Element, aber man kann das auch mit unterschiedlichen Sprachen hinbekommen.
Wenn man sich die Debatte über die Euro-Krise angeschaut hat, dann wurde die in Italien ganz anders geführt als etwa in Österreich, Deutschland und anderswo. Wie soll also die Idee eines europäischen Volkes funktionieren, wenn Europa in nationale Debatten zerfällt?
Wir sollten zunächst anerkennen, dass wir schon viel erreicht haben und sich die Beziehungen vervielfältigen, besonders in der jungen Generation, die ein weit ausgeprägteres europäisches Bewusstsein hat als etwa die ältere Generation. Dann gibt es Debatten in unterschiedlichen Sprachen auch innerhalb einzelner Länder. Politik ist immer Vermittlung. Das Problem ist, zu entscheiden, ob wir vorangehen wollen oder zurück. Es werden die Notwendigkeiten der Welt sein, die uns voranzwingen. Manchmal macht man aus der Not eine Tugend. Warum etwa ist es in den vergangenen Monaten zum zarten Wiederaufleben eines verstärkten Europabewusstseins gekommen? Das erwächst aus Angst, aus dem Problem des Brexits und der Spannung, die Trump auslöst. Es ist klar, dass Europa nicht auf proeuropäischer Angst aufbauen sollte, quasi als Gegenentwurf zur Angst der Antieuropäer. Es ist aber auch wahr, dass Angst hilft, einen Sinn von Geschichte zu vermitteln.
Sie hilft, Dinge in eine historische Perspektive zu rücken?
Ja. Natürlich kann man sich auch irren, wie damals die italienischen Einzelstaaten, denen klar sein musste, dass ihre Uneinigkeit zur Invasion ausländischer Armeen führen würde, so, wie Machiavelli (/181402752)es beschrieben hatte. Es gab damals aber niemanden, der das Land geeint hat. Man kann also auch an der Herausforderung der Geschichte versagen. Heute kann aber nicht mal das große Deutschland gegen die USA oder China bestehen. Es gibt immer irgendwo ein Dieselproblem in der Welt. Es gibt da ein kalabresisches Sprichwort: Wer sich selbst zum Schaf macht, wird vom Wolf gefressen.
Wenn Sie drei Wünsche frei hätten an Deutschland, etwa welche europapolitischen Weichen Berlin verändern sollte. Welche wären das?
Versucht, den Motor mit zwei Zylindern wiederherzustellen, um Europa einen Entwicklungspfad aufzuzeigen. Das kann Deutschland nicht allein, man braucht dazu auch Frankreich.
Deutschland und Frankreich sollen also wieder die treibenden Kräfte Europas werden?
Es geht darum, eine aktive Politik zu verfolgen, die Erfolge erzielt. Dann wird es auch in anderen Ländern Veränderungen geben. Im Moment gibt es keine Lokomotive. Ich hätte eine Europawahl mit zwei Spitzenkandidaten vorgezogen, die sich politisch mit Programmen für Europa bekämpfen, und nicht europäische Wahlen, die in nationale Visionen zersplittern so wie diese. Wenn wir das gemacht hätten, dann hätten wir auch wieder Freude an Europa. Was ich von Deutschland verlange, ist, sich bewusst zu werden, dass eine gemeinsame Führung in diesem Moment sehr wichtig ist. Auch Deutschlands Zukunft steht auf dem Spiel, nicht nur die Europas. Auf diese Weise wird es dann auch für mein Land möglich sein, wieder die wichtige Rolle einzunehmen, die Italien in Europa immer gehabt hat.